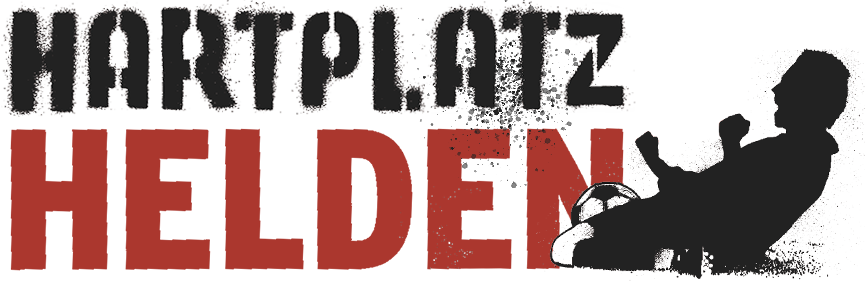Der klassische Verein wird nicht verschwinden, doch als alleiniges Modell ist er nicht zukunftsfähig. Zeit, sich nach neuen Wegen umzusehen.
Gleich zweimal wurde mir zuletzt diese Frage gestellt: „Ist der klassische eingetragene Verein noch zeitgemäß?“
Als langjähriger Vereinsmensch musste ich schlucken. Dürfen wir das bewährte System infrage stellen? Ja unbedingt. Neue Ideen verschwinden nicht, wenn man sie ignoriert. Fußball braucht Diskussionen, um lebendig zu bleiben. Auch deshalb kandidiere ich für einen Platz im DFB-Präsidium.
Dass die Frage aufkommt, hat gute Gründe, viele e.V. stoßen hier an ihre Grenzen:
- ehrenamtliche Strukturen
- finanzielle Rahmenbedingungen
- Wertschätzung und Belastung der Engagierten
In der vielfältigen Sportlandschaft existieren kleine Vereine mit zwei Teams, mittelgroße Clubs mit fünf Erwachsenen- und zehn Jugendmannschaften sowie große Organisationen mit über 1.000 Mitgliedern und mehr als 50 Teams. Es ist ratsam, die Besonderheiten dieser Strukturen zu berücksichtigen. Fest steht jedoch: Je größer der Verein, desto schwieriger ist es, den Betrieb ausschließlich ehrenamtlich aufrechtzuerhalten. Wer möchte schon freiwillig für 50 Mannschaften Trainingspläne erstellen, Sportkleidung verwalten, Sponsoren akquirieren und sich um Verbandsarbeit kümmern?
Wir müssen festhalten: Es ist weder sinnvoll noch fair, diese enorme Last nur wenigen hochengagierten Ehrenamtlichen zu überlassen. Dennoch scheuen sich viele Vereine, professionelle Strukturen einzuführen – oft aus Sorge, dass dadurch Mitgliedsbeiträge steigen. Die Debatte darüber schreckt viele Vorstände ab, da sie fürchten, die Zustimmung der Mitglieder zu verlieren.
Doch es ist ganz einfach – wie Marthe Lorenz von Klubtalent betont: „Man zeigt den Mitgliedern, was sie bei der teureren Variante A und was bei der günstigeren Variante B erhalten. Manchmal gibt es noch eine dritte Option, am Ende entscheidet die Mitgliederversammlung.“ Transparenz und Ehrlichkeit sind Grundlagen eines demokratischen Prozesses. Die Botschaft: Gute Dienstleistungen und hochwertige sportliche Ausbildung gibt es nicht zum Nulltarif.
Leider treffen in vielen Vereinen eine oder zwei Personen alleine die Entscheidungen. Trainer werden hinter verschlossenen Türen ausgesucht, teures Privattraining bei Bekannten der Verantwortlichen empfohlen und Eltern verpflichtet, umfangreiche Sportbekleidungspakete zu kaufen – wobei die Differenz von Einkaufs- zu Katalogpreis nicht immer transparent in die Jugendkasse fließt.
Ähnliches gilt für Ausbildungsentschädigungen: Einzelpersonen verhandeln die „Ablösesummen“ und rechnen sie ab – ohne unabhängige Kontrolle. Mir ist ein Fall bekannt, in dem ein Verantwortlicher mit 40.000 Euro aus Ablösesummen verschwand. Ein Einzelfall, aber ein deutliches Warnsignal. Viele Vereine sind längst keine „kleinen Klitschen“ mehr, sondern wirtschaften wie mittelständische Unternehmen, teilweise mit sechsstelligen Umsätzen. Das bringt große Verantwortung mit sich, über die nur selten gesprochen wird.
Größere Vereine sollten deshalb Personal und Strukturen professionalisieren. Es gibt mittlerweile viele gut ausgebildete, sportbegeisterte junge Menschen, die gern im Verein arbeiten würden. In der Bundesliga sind die Stellen begrenzt, da ein Großteil der Einnahmen an Profis und Berater fließt. Ein grundsätzlicher Wandel zur Professionalität steht in vielen Bereichen jedoch noch aus. Gleichzeitig fällt es Vereinen oft leichter, die Spieler der ersten Herrenmannschaft auf verschiedenste Weise zu „vergüten“, statt in administrative Strukturen zu investieren.
Es empfiehlt sich daher, über die Ausgliederung einzelner Bereiche – etwa in eine GmbH – nachzudenken, zum Beispiel für Feriencamps, Veranstaltungsreihen, Schul-AGs oder gesellschaftspolitische Projekte. Viele Vereine nutzen diese Modelle insbesondere für ihre Leistungsteams, um Risiken für den e.V. abzufedern. Problematisch wird es jedoch, wenn eine solche GmbH durch den Verein gestützt wird und die Vorgaben zur Gemeinnützigkeit missachtet werden – auch das kommt vor.
Geärgert habe ich mich über die Aussage eines Sprechers eines Landessportbundes: „Wenn ich meinen Mitgliedsbeitrag zahle, habe ich natürlich Anspruch auf qualifiziertes Personal.“ Nichts gegen gutes Personal, aber die genaue Definition bliebe spannend. Die Aussage ist sinnbildlich für das Dilemma: Selbst Sprecher der Sportverbände verstehen Vereine nicht als Gemeinschaft, sondern als Dienstleister. Mit einer solchen Sichtweise ist es kein Wunder, dass die Politik Vereine nicht ernst nimmt. Werden sie auf Dienstleistung reduziert, entfällt zumindest bei mir der Anreiz für ehrenamtliches Engagement.
Fazit: Der klassische eingetragene Verein wird so schnell nicht verschwinden. Doch als alleiniges Modell ist er zumindest ab einer gewissen Größe nur bedingt zukunftsfähig – auch, weil es immer schwerer wird, genug Ehrenamtliche zu gewinnen. Nicht alle Vereine oder Vorstände tun sich leicht mit betriebswirtschaftlichen Aufgaben – aber das wird zunehmend notwendig. Die Diskussion steckt in den Anfängen, den Ausgang kann niemand vorhersehen. Wer sich aber jetzt nicht mit der eigenen Zukunft befasst, wird sie kaum aktiv gestalten.
Vereine können bereits heute kompetente Unterstützung in Anspruch nehmen: Unsere Hartplatzheldin Susanne Amar berät in Sachen Ehrenamt und Elternarbeit, Klubtalent begleitet Vorstände bei Aufgaben und Entwicklung, und beim FC Internationale haben wir das Glück, eine Expertin für Organisationsentwicklung im Vorstand zu haben. Wer seinen Verein zukunftssicher aufstellen will, muss sich mit diesen Themen beschäftigen.
Unseren Sportverbänden rate ich, ihre Kampagnenfähigkeit zu stärken. 2025/26 finden in allen großen Bundesländern Kommunal- oder sogar Landtagswahlen statt. Es wäre wünschenswert, wenn DFB und Landesverbände mehr Ideen präsentieren als die vage Hoffnung auf Olympische Spiele in Deutschland. Die Vorstände der Vereine würden sich freuen, wenn die Politik sie endlich ernst nimmt.
Foto von Alberto Frías auf Unsplash